Essay-Recherche
Eine Begrüßung ist ein Zeichen des Vertrauens und der Würde einer Person. In Etikette verschiedene Länder viele Grüße. Es könnte ein Kopfnicken, eine Verbeugung, ein Händedruck, ein Kuss oder einfach nur „Hallo“ und „Hallo“ sein.“
Die Formen der Begrüßung waren schon immer äußerst vielfältig. Es gibt eine Geschichte über den Massai-Stamm, die sie sich auf die Hände spucken, bevor sie einander gratulieren.
Wenn Tibeter ihre Hüte abnehmen, strecken sie ihre Zunge heraus und halten ihre linke Hand hinter ihr Ohr, als ob sie zuhören würden. Maori-Leute berühren sich gegenseitig an der Nase. Und in England begrüßt eine Frau auf der Straße in der Regel zuerst einen Mann, da ihr das Recht eingeräumt wird, zu entscheiden, ob sie ihre Bekanntschaft mit diesem Mann öffentlich bestätigen möchte.
Bei der Begrüßung nehmen die Europäer ihre Hüte ab und verbeugen sich leicht. Die Japaner haben drei Arten von Verbeugungen zur Begrüßung: niedrig, mittel und leicht (mit einem Winkel von 15 Grad).
Russen, Briten und Amerikaner grüßen einander per Handschlag; Früher schüttelten die Chinesen sich selbst die Hand, wenn sie sich trafen. Die Lappländer reiben sich die Nase, der junge Amerikaner gratuliert seinem Freund und klopft ihm auf die Schulter; Latinos umarmen sich; die Franzosen küssen sich gegenseitig auf die Wange; die militärischen Grüße; Samoaner beschnüffeln sich gegenseitig; Moderne Griechen gratulieren einander mit den Worten: „Sei gesund!“, englische und amerikanische Schulkinder – mit dem Ausruf: „Hey!“ Die alten Griechen sagten zur Begrüßung zueinander: „Freut mich!“; Araber gratulieren einander mit dem Satz: „Friede sei mit euch!“ und Navajo-Indianer – mit dem Satz „Alles ist gut!“
Demokratische Etikette moderne Gesellschaft Der Schwerpunkt liegt zunehmend auf Humanismus, Gleichheit und Gerechtigkeit in den Beziehungen zwischen Menschen. In der demokratischen Etikette wird die Regel zunehmend akzeptiert und sogar zur Norm: Der Höflichere wird zuerst begrüßt. Wenn der Arzt den Patienten als Erster begrüßt, können wir sagen, dass er dies im Rahmen der demokratischen Etikette tut. Wenn ein Lehrer seine Schüler zuerst begrüßt, tut er dies ebenfalls nach den Gesetzen der demokratischen Etikette. Wenn ein Schüler der Erste ist, der den Lehrer begrüßt, tut er dies auf Wunsch seines Herzens und gratuliert dem Älteren als Zeichen des Respekts.
Warum sagen die Leute Hallo? Von den ersten Lebensmonaten an beginnen fürsorgliche Eltern, ihrem rotwangigen Baby beizubringen, die Welt um sich herum zu begrüßen, indem es mit seiner pummeligen Hand winkt, und sind aufrichtig berührt, wenn das Baby beginnt, diese einfache Geste selbst zu wiederholen. Später schließen sich Erzieher und Lehrer diesem Prozess an und erinnern sie ständig daran, dass wohlerzogene Kinder ihre Älteren begrüßen müssen. Aber die Kleinen, naiv in ihrer Einfachheit, legen darauf keinen Wert. Erst wenn man erwachsen ist, versteht man, wie wichtig eine aufrichtige Begrüßung ist, die zu einem festen Bestandteil unseres Lebens wird.
Wo beginnt „Hallo!“...
Kaum war er von allen Vieren aufgestanden, begann der zukünftige Mann zu erkennen, wie wichtig das Team ist. Ruhiger und sicherer war es neben denselben struppigen und ungeschickten, aufrecht gehenden Primaten. Natürliche Selektion unter Bedingungen Tierwelt war sehr groß, daher freuten sich die Australopithecinen sehr, als sie ihre Verwandten sahen, und stießen gleichzeitig eigenartige Schreie aus, die bedeuteten: "Ich bin wie du!", „Du musst keine Angst vor mir haben“. Als Antwort erhielt er das gleiche durchdringende Knurren und beide waren mit diesem Treffen zufrieden.
Mit der Entwicklung der Menschheit wurden wilde Schreie und Knurren durch bestimmte Gesten ersetzt. Beim Treffen zeigten die Wilden ihre erhobenen Handflächen und demonstrierten damit das Fehlen von Waffen, das bedeutete: "Ich komme in Frieden!" Jeder Stamm hatte sein eigenes Begrüßungsritual, das ihm als Passwort diente, und Fremde wurden mit Feindseligkeit begrüßt und einer sorgfältigen Prüfung unterzogen. Später nahm die Begrüßung in Worten, Sätzen und Gesten Gestalt an, aber alles bleibt, genau wie vor zwei Millionen Jahren, ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens.
Wie könnte eine Begrüßung aussehen?
Abhängig von der Situation, den Menschen um uns herum und den stattfindenden Ereignissen kann die Begrüßung ausgesprochen werden mit anderen Worten und mit unterschiedlicher Intonation. Die häufigsten Begrüßungsformen:
- Lässig . Dies ist eine neutrale Form der Kommunikation zwischen vertrauten Menschen, die keine starken Gefühle füreinander empfinden. Dabei spielen Geschlecht, Alter oder sozialer Status keine Rolle. Damit gibt eine Person lediglich ihre Bekanntschaft mit dem Gesprächspartner und den Grad ihrer Erziehung an.
- Verwandt . Die einfachste und leicht abweisende Form der Begrüßung. Angehörige wissen bereits alles, was man für sie empfindet, daher ertönt in vielen Familien das übliche „Hallo!“ und ein kurzer auf die Wange.
- Offiziell oder geschäftlich . Am häufigsten wird dies durch einen Händedruck ausgedrückt und sofort gegeben Weitere Informationenüber den Partner. Es kann ein schwacher Händedruck mit kalter Handfläche sein oder ein starker und selbstbewusster, manchmal geradezu aggressiver. Diese Form der Begrüßung vermittelt stark die Energiebotschaft und die innere Stimmung.
- Verspielt, küssend . So begrüßen sich Mädchen normalerweise, und hinter dem Bildschirm der Freude ist es sehr schwierig, die aufrichtigen Gefühle für den Gesprächspartner zu verstehen. Dies kann entweder aufrichtige Freude oder offener Neid oder Hass sein.
- Stürmisch . Diese Begrüßung ist nur bei sehr engen Freunden oder geliebten Menschen akzeptabel. Mit lauten Ausrufen können Sie sich in Umarmungen werfen, während Sie nur jemanden küssen und streicheln, den Sie schon lange nicht mehr gesehen haben und den Sie schrecklich vermissen.
- Originell und ungewöhnlich . Dies könnte ein bestimmter Handtanz sein, eine Kombination koordinierter Bewegungen, eine Art Passwort, das auf enge Freundschaften hinweist.
- Unsicher .So verhalten sich Menschen, die sich nicht kennen oder normalerweise gegrüßt werden, wenn sie versehentlich die Augen schielen und ihre Höflichkeit zeigen wollen. Dies kann ein leichtes Kopfnicken oder eine stille Bewegung der Lippen sein.

Wie man den Charakter einer Person anhand der Art und Weise bestimmt, wie sie grüßt
Begrüßung ist Visitenkarte irgendjemand Durch die Betonung und das Selbstbewusstsein, mit dem er sich äußert, kann man sich einen genauen Überblick über seinen Zustand und seinen emotionalen Hintergrund verschaffen. Unsichere Menschen sagen das leise und schüchtern. Führungskräfte melden sich lautstark und trotzig zu Wort. Betrüger machen sich beliebt und schmeicheln. Arrogante oder ignorante Menschen tun dies herablassend und widerwillig. Die übliche Begrüßung lässt sich belegen durch:
- Respektieren;
- Enge oder formelle Beziehungen;
- Schüchternheit;
- Wut und Reizbarkeit;
- Gleichgültigkeit;
- Arroganz oder Verachtung;
- Liebe;
- Aufrichtige Teilnahme und Hilfsbereitschaft;
- Anhang.
Wie sie es in anderen Ländern machen
Die moderne Welt besteht aus mehr als zweihundert Ländern und jedes von ihnen hat seine eigenen Traditionen, Bräuche und Mentalität, die sich über Jahrtausende herausgebildet haben. Jede Kultur hat ihre eigenen Begrüßungsmerkmale, die berücksichtigt werden müssen:
- In Neuseeland gibt es noch immer den Brauch, zur Begrüßung die Nase zu berühren und leicht zu reiben;
- In Tibet strecken sie bei Begegnungen die Zunge heraus und kreuzen die Handflächen auf der Brust;
- In Tuvalu pressen sie ihr Gesicht an ihre Wange und atmen tief durch;
- In der Mongolei wird einem lieben Gast feierlich ein weißes Seidenband überreicht, was ein Zeichen besonderen Respekts ist;
- In Japan sind tiefe und lange Verbeugungen bis zur Taille üblich;
- Kenia empfängt Gäste mit rituellen Tänzen mit hohen Sprüngen;
All diese wunderbaren Traditionen gehören nach und nach der Vergangenheit an und werden durch den üblichen europäischen Händedruck ersetzt.
Im Durchschnitt sagt ein Mensch an jedem Arbeitstag „Hallo!“ mehr als zwanzig Mal und denkt nicht einmal darüber nach, dass dies nicht nur ein Zeichen von Respekt und guten Manieren ist, sondern eine starke Energiebotschaft an das Universum. Die Gläubigen glauben aufrichtig, dass auch dem Feind gute Gesundheit gewünscht werden sollte, denn dadurch kehren alle unsere Botschaften wie ein Bumerang mit dreifacher Stärke zu uns zurück. Dies geschieht auf energetischer Ebene, daher müssen Sie bei Ihren Wünschen sehr vorsichtig sein, insbesondere wenn sie im Eifer des Gefechts geäußert werden.

Viele von uns bemerken, dass das einfachste Wort „Hallo“, gesprochen mit einem freundlichen Lächeln, sofort unsere Stimmung hebt und unser Wohlbefinden verbessert. Damit macht der Gesprächspartner deutlich, dass er Ihnen Wohlbefinden wünscht und freundlich ist, was selbst für eingefleischte Zyniker sehr wichtig ist. Aus all dem können wir schließen, dass es großartig ist, Hallo zu sagen! Mit nur einem Wort können Sie Ihrem Gesprächspartner die gesamte Bandbreite Ihrer Gefühle vermitteln und ihn in die richtige Stimmung versetzen, den Ton für Ihre zukünftige Beziehung angeben und ein wenig glücklicher werden.
Artikel: Russisch
Klasse: 5
Unterrichtsart: Unterrichtseinheit zur ersten Präsentation neuen Wissens
Routenführung das Thema studieren
Thema
Sprachentwicklung. Pädagogische ausführliche Präsentation basierend auf dem Text von F. Krivin „Warum müssen Sie Hallo sagen?“
Ziel
Entwickeln Sie die Fähigkeit, Texte schriftlich darzustellen, und vermitteln Sie Fähigkeiten unabhängige Arbeit
Lernziele:
Lehrreich:
Verstärken Sie das Konzept der „detaillierten Präsentation“;
Entwickeln Sie Gedächtnis, Sprache, logisches und figuratives Denken;
Lernen Sie, einen narrativen Text ausführlich mit Elementen einer Beschreibung des Themas darzustellen;
Verbessern Sie die Fähigkeit, das Thema und die Hauptidee des Textes offenzulegen
Lehrreich:
entwickeln Gedächtnis, Sprache, logisches und fantasievolles Denken
Pädagogen:
- eine Sprachkultur pflegen,
zur Sprache bringen verschiedene Typen Schülerkompetenz (Sprache, Sprache, Linguistik, Rechtschreibung)
Geplante Ergebnisse:
persönlich
Die Fähigkeit, sprachliche Äußerungen hinsichtlich ihres Inhalts und der Verwendung sprachlicher Mittel zu vergleichen und gegenüberzustellen.
Metasubjekt
Beherrschung der Grundkonzepte der Linguistik: Mittel zur Verbindung von Sätzen im Text.
Thema
Sie lernen, den Text mündlich und schriftlich nachzuerzählen, die Hauptidee des Textes zu bestimmen, den Text zu betiteln und sprachliche Phänomene zu erklären
Grundlegendes Konzept
Kommunikation, seriell, parallel
Lehrmethoden und -techniken
Überwachung;
Textanalyse;
Kreativwerkstatt;
Wortzeichnen;
Formen der Organisation der kognitiven Aktivität der Schüler
kollektiv, individuell
Interdisziplinäre Verbindungen
Literatur, Geschichte
Technologische Unterrichtskarte
Unterrichtstechnik
Aktivität
Lehrer
Aktivität
Studenten
Aufgaben für Studierende, deren Erledigung zum Erreichen geplanter Ergebnisse führt
UUD gegründet
ICH .
Prüfung der Unterrichtsbereitschaft der Schüler (Abwesenheitsprüfung; emotionale Stimmung)
Hallo Leute!
Bericht des diensthabenden Beamten. Konzentration auf den Unterricht.
1) Regulatorisch:
Willensselbstregulierung;
2) Persönlich:
Sinneswahrnehmung (ich muss mal schauen...)
3) Kommunikation:
Planung der pädagogischen Zusammenarbeit mit dem Lehrer und mit Gleichaltrigen.
II. Wissen aktualisieren
Aktuelle Kontrolle von Wissen und Fähigkeiten.
- Aufwärmen der Sprache
Heuristisches Gespräch. In der letzten Lektion haben wir über den Text gesprochen. Erinnern wir uns an die Besonderheiten des Textes.
Welche Wörter gelten für uns als Sprachetikette?
Heute stellen wir den Text im Detail vor.
Was bedeutet Textpräsentation?
Beantworten Sie Fragen zum Text.
Unterscheidungsmerkmale Text.
Thema.
Hauptgedanke. Mikrothema.
Sprachetikette.
1) Regulatorisch:
Willensselbstregulierung;
2) Persönlich:
Fähigkeit, erledigte Aufgaben zu bewerten;
3) Kommunikation:
Planung der pädagogischen Zusammenarbeit mit dem Lehrer und mit Gleichaltrigen
III .
Bildungsziele festlegen. Motivation
Leute, welche Aufgaben stellt ihr euch traditionell, um eine so schwierige Aufgabe wie das Verfassen einer ausführlichen Zusammenfassung erfolgreich zu meistern?
Sie beantworten die Frage.
– das Thema und die Idee des Textes verstehen;
- Geben Sie den Text an:
im Detail; der Reihe nach;
Schön;
- Schreiben Sie den Text richtig auf.
Regulatorisch:
Streben nach erfolgreichen Aktivitäten.
Persönlich:
Bringen Sie eine positive Einstellung zum Lernprozess zum Ausdruck und zeigen Sie den Wunsch, Neues zu demonstrieren.
Gesprächig:
Bildung der Fähigkeit zuzuhören und zu hören.
IV . Arbeiten Sie am Thema der Lektion
Kreative Anwendung und Wissenserwerb in einer neuen Situation (Problemaufgaben)
Unterrichtsaufgaben.
Gut gemacht, Jungs. Beginnen wir mit der Lösung der Probleme. Wo beginnt traditionell eine Unterrichtsstunde? ( Von Bewegung zu Aufmerksamkeit.)
Wir werden den Flug des Herbstlaubs verfolgen. Er wird auf seinem Flug Zwischenstopps einlegen. Wenn Sie vorsichtig sind, können Sie entlang der Bewegungsbahn zwei Wörter bilden, sie aufschreiben und Wörter mit derselben Wurzel auswählen. Konzentriert. Lasst uns beginnen.
- Was ist passiert? (Menschliche Gesundheit).
Und wann wünschen wir einem Menschen Gesundheit?
Konzentration auf die Aufgabe.
Fähigkeit, nach Lösungen zu suchen und Ergebnisse zu analysieren
D
Z*
e
H
e
l
Ö
V
B
e
V
Ö
R
Ö
T
Zu
A
Mit
Erstes Wort: links, unten, unten, rechts, oben, rechts, oben (Gesundheit);
Zweites Wort: rechts, rechts, rechts, unten, links, links, unten, rechts, (Person);
– Leute, was wird Ihrer Meinung nach im Text der Präsentation besprochen? (Antwortmöglichkeiten).
Hallo.
1) Regulatorisch:
Zielsetzung als Einstellung pädagogische Aufgabe,
Planung,
Prognose.
2) Kognitiv:
Die Fähigkeit, Wissen zu strukturieren, ein Problem zu stellen und zu formulieren, die Fähigkeit, bewusst und freiwillig Sprachaussagen zu konstruieren.
3) Allgemeinbildung:
Modellieren,
Auswahl der effektivsten Wege zur Problemlösung.
V . Konsolidierung des Neuen.
Arbeit am Text.
- Worum geht es in diesem Text? (Antworten der Schüler.)
Der Zweck dieser Präsentation besteht darin, den Inhalt des Textes zu vermitteln und dabei, wenn möglich, die lebendigen visuellen Mittel beizubehalten, mit denen der Autor den herbstlichen Laubfall beschreibt.
Hören Sie sich den Text noch einmal an und denken Sie nach komplexer Plan, wobei Mikrothemen in separate Unterabschnitte unterteilt werden.
Planung.
– Sagen Sie mir, welche der von Ihnen gestellten Aufgaben werden Ihnen bei der Umsetzung des Plans helfen?
Und der letzte Schritt Ihrer Arbeit ist die Vorbereitung auf kompetentes Schreiben. Aufgaben und Wörterbücher helfen Ihnen dabei treue Helfer.
Zu welcher Redeart gehört der Vortragstext?
2. Welchem Redestil gehört der zu präsentierende Text an?
Sie wurden nachdenklich, Medizin, sie fühlten, hallo, auf Wiedersehen, sie fühlten.
Arbeiten mit einem Entwurf.
Arbeiten mit einem sauberen Blatt.
Lesen Sie das Memo „So bereiten Sie sich auf eine ausführliche Präsentation vor.“
(geben Sie den Text der Reihe nach an)
Lesen Sie den Text auf den Seiten 31-32.
Beachten Sie die Notiz auf dem Vorsatzblatt des Lehrbuchs.
Es ist natürlich einfacher, nicht Hallo zu sagen.
So lebten Höhlenmenschen.
Eines Tages wurden sie krank.
Ursache der Krankheit.
Die Höhlenmenschen wurden nachdenklich.
"Guten Tag!".
Seitdem sagen die Leute einander Hallo.
A) Erzählung;
B) Begründung;
B) Beschreibung.
A) journalistisch;
B) künstlerisch;
B) Konversation.
Regulatorisch:
Bringen Sie Ihre Version zum Ausdruck
Gesprächig:
äußern Sie Ihre Gedanken mündlich; hören Sie zu und verstehen Sie die Sprache anderer; arbeiten in einer Gruppe
Kognitiv:
Gewinnen Sie neues Wissen: Finden Sie Antworten auf Fragen anhand Ihrer Lebenserfahrung; Informationen in komprimierter Form präsentieren
VI . Hausaufgaben.
Führt Analysen durch Hausaufgaben, gibt Erläuterungen zur Übung, gibt konstruktive Aufgaben
Schreiben Sie Hausaufgaben auf und stellen Sie Fragen
T. Seite 38-39., Nr. 48.
Regulatorisch:
Identifizierung und Bewusstsein der Studierenden für das, was bereits gelernt wurde und was noch gelernt werden muss, Bewusstsein für die Qualität und den Grad der Assimilation;
Kognitiv:
Konvertieren des Modells, um es an den Inhalt anzupassen Unterrichtsmaterial und das gesetzte Bildungsziel.
Selbstständige Formulierung eines kognitiven Ziels;
Aufbau einer logischen Argumentationskette;
Selbstständige Erstellung von Aktivitätsalgorithmen bei der Lösung von Problemen kreativer und suchender Natur;
Gesprächig:
Befragung – proaktive Zusammenarbeit bei der Suche und Sammlung von Informationen;
Fähigkeit zuzuhören und in den Dialog einzutreten
VII .
Reflexion über Lernaktivitäten im Klassenzimmer.
Fragen stellen
über die Ziele des Unterrichts. Fragt, welche Aufgabe noch übrig bleibt
für die nächsten Lektionen
Haben Sie Ihre Aufgaben für die Lektion erledigt?
Modellaussage:
Ich habe es heute herausgefunden...
Führen Sie eine Selbstbewertung Ihrer eigenen Bildungsaktivitäten durch, korrelieren Sie Ziel und Ergebnisse sowie den Grad ihrer Einhaltung.
Was ist uns in der heutigen Lektion gelungen? Was wird Ihnen von diesem Treffen in Erinnerung bleiben? Wer hat etwas Neues für sich gelernt?
Abschließender Kommentar
Regulatorisch:
Bewertung – Bewusstsein für die Qualität und das Niveau der Beherrschung und Beherrschung bestimmter Bildungsaktivitäten;
Endkontrolle durchführen
Persönlich:
Bewerten Sie Ihre eigenen Bildungsaktivitäten: Ihre Leistungen, Grad der Unabhängigkeit, Initiative, Gründe für Misserfolge.
Gesprächig:
Die Fähigkeit, in Zusammenarbeit mit Gleichaltrigen und Erwachsenen produktive Interaktionen aufzubauen.
Seien Sie aktiv bei Aktivitäten.
"Hallo guten Tag", "Hallo"- wie oft hören wir diese einfache Worte, aber sie können auch viele Fragen provozieren. Wissen Sie zum Beispiel: Wer sollte zuerst Hallo sagen? Wie sagt man Hallo? Was für Grüße gibt es? Und in welchem Fall ist es einfach unanständig, Hallo zu sagen?
Nach den Regeln der Etikette begrüßt ein Mann zuerst eine Frau, ein Junior begrüßt zuerst eine Frau und ein gewöhnlicher Angestellter begrüßt seinen Chef, und das ist alles klar, aber es gibt Situationen, die geklärt werden müssen.
Wer soll zuerst Hallo sagen?
Gut erzogene Menschen sagen Hallo, wenn sie sich treffen – es scheint, dass daran nichts Kompliziertes ist? Allerdings ist Etikette eine heikle Angelegenheit. Vieles davon basiert auf dem Prinzip des nachdrücklichen Respekts. Demnach grüßt der Mann zuerst die Frau, der Jüngere grüßt den Älteren und der normale Angestellte grüßt den Chef.
Dies gilt für mündliche Begrüßungen. Anschließend erfolgt wie gewohnt ein Handschlag. Und hier ist die Situation anders. Gemäß der Etikette leitet die angesehenste Person den Händedruck ein: Der Ältere schüttelt dem Jüngeren die Hand, der Chef schüttelt dem Untergebenen die Hand, die Frau schüttelt dem Mann die Hand. Der Mann muss warten, bis die Frau ihre Hand zum Händeschütteln ausstreckt, aber wenn diese Geste nicht folgt, beschränken Sie sich auf eine leichte Verbeugung. (Der Brauch, Frauen die Hände zu küssen, wird heute praktisch nicht mehr verwendet; er ist nur in Polen erhalten geblieben.)
Wie Sie sehen, ist es gar nicht so einfach, richtig Hallo zu sagen. Und wenn man bedenkt, dass man sich bei der Arbeit unter verschiedenen Umständen begrüßen muss, wird das Thema noch verwirrender. Naja, wer soll zum Beispiel zuerst Hallo sagen: die junge Sekretärin bzw Generaldirektor Wer ist alt genug, um ihr Vater zu sein? Einerseits sollte das Mädchen dem Älteren Respekt entgegenbringen und als Erstes „Hallo“ sagen, aber der Generaldirektor sollte auch nicht vergessen, dass er ein Mann ist, der verpflichtet ist, Frauen zuerst zu begrüßen. Wie sein? Es hängt alles davon ab, wie sich der Chef positioniert. Wenn er sich für einen Mann in der Blüte seines Lebens hält, wird er sich beeilen, „Hallo“ zu sagen. Wenn der Chef mit jeder Zelle seines Körpers spürt, wie Sand aus ihm herausfließt, kann er warten, bis das Mädchen Respekt vor seiner Position zeigt, und mit einem gnädigen Nicken antworten.
Es gibt noch andere Feinheiten. Wenn eine Frau den Raum betritt, muss laut Etikette der sitzende Mann aufstehen, um sie zu begrüßen. (Eine Frau in einer ähnlichen Situation steht nur auf, wenn sie eintritt Alter Mann.) Nehmen wir nun an, dass der Chef einen Untergebenen auf den Teppich rief, den er an diesem Tag noch nicht gesehen hatte. Das bedeutet, dass er aufstehen, den Tisch verlassen, die Arme senken, „Hallo“ sagen und erst dann schimpfen muss – es sei denn natürlich, die Leidenschaft geht verloren (vielleicht wurde die Etikette zu diesem Zweck erfunden, um Konflikte im Keim zu ersticken? ).
Nun, wie begrüßt man sich, wenn sich zwei Ehepaare treffen? In diesem Fall begrüßen sich zuerst die Frauen, dann die Männer und erst danach die Frauen. Wenn das Treffen außerdem auf der Straße stattfindet, ziehen Männer zum Händeschütteln die Handschuhe von der rechten Hand aus. Frauen sollten nur dicke Pelzhandschuhe und Fäustlinge ausziehen; dünne Handschuhe müssen nicht ausgezogen werden.
Im Allgemeinen ist ein Mann mit Selbstachtung immer der Erste, der Frauen begrüßt ... es sei denn, es sind Engländer: In diesem Land gehört dieses Privileg den Damen.
Kommen wir zurück zum Händedruck. Der Brauch des Händeschüttelns stammt aus der Antike, als bei einer Versammlung gezeigt wurde, dass sich weder ein Stein noch eine andere Waffe in der Hand befand. So wurde der Händedruck zum Symbol des guten Willens.
Der Händedruck sollte kurz und kräftig sein und man sollte auf Augenhöhe sein. Es ist nicht gut, entspannt die Hand anzubieten, aber es ist auch nicht gut, die Hand des Partners zu drücken und mit aller Kraft zu schütteln. Psychologen glauben übrigens, dass man durch das Händeschütteln viel über eine Person erfahren kann. Ein galanter Händedruck bedeutet beispielsweise, dass eine Person weiß, wie sie sich an andere Menschen anpassen kann. Wenn die Hand hart und gefroren ist, haben wir eine harte Person vor uns, die von anderen Unterwerfung verlangt. Der Körper der Person, die uns die Hand reicht, ist nach vorne geneigt – das bedeutet, dass sie an Kommunikation interessiert ist. Eine breite Geste von der Seite bedeutet, dass diese Person einfältig ist.
Denken Sie daran, dass Sie einen Raum mit mehreren Personen nicht betreten und nur einer von ihnen die Hand schütteln dürfen – Sie müssen allen anderen die Hand reichen.
Bei der Kommunikation mit Ausländern muss man bedenken, dass der Händedruck vor allem in Amerika, aber auch in Europa, weit verbreitet ist. Amerikaner und Westeuropäer legen Wert auf einen starken Händedruck: Unanständig zu sein gilt in diesen Ländern als schlechtes Benehmen. Ausdrucksstarke Amerikaner gehen oft über einen Händedruck hinaus und klopfen ihnen zusätzlich auf die Schulter. Im Gegenteil könnten Bewohner Asiens solche Handlungen als unangenehme Vertrautheit und einen Angriff auf die persönliche Freiheit empfinden. In Indien, China und Japan wird das Händeschütteln überhaupt nicht akzeptiert. In Japan werden zur Begrüßung drei Arten von Verbeugungen verwendet (abhängig vom Grad des ausgedrückten Respekts): die niedrigste Verbeugung, eine mittlere Verbeugung in einem Winkel von 30 Grad und eine leichte Verbeugung in einem Winkel von 15 Grad. Bei manchen Völkern hat die Begrüßung eine noch exotischere Form: Beispielsweise berühren sich die in Neuseeland lebenden Maori-Stämme bei der Begegnung die Nase.
Die Situationen sind unterschiedlich
Wenn Sie in der Ferne (auf der anderen Straßenseite, im Bus usw.) einen Bekannten bemerken und Sie auch bemerkt werden, müssen Sie die Person mit einem Kopfnicken oder einer Handbewegung begrüßen , eine Verbeugung, ein Lächeln. Sie sollten nicht laut schreien – Sie bringen ihn und sich selbst in eine unangenehme Situation.
Wenn Sie sehen, dass ein Freund auf Sie zukommt, müssen Sie nicht aus der Ferne „Hallo“ rufen. Warten Sie, bis sich der Abstand zwischen Ihnen auf wenige Schritte verringert hat, und begrüßen Sie ihn dann.
Wenn Sie mit jemandem spazieren gehen und Ihr Begleiter einen Fremden begrüßt, sollten Sie auch Hallo sagen.
Wenn Sie jemanden, den Sie kennen, in Begleitung eines Fremden treffen, sollten Sie beide begrüßen. Sie sollten auch jeden in der Gruppe, die Sie ansprechen, begrüßen.
Wenn Sie in einer Gruppe spazieren gehen und jemanden treffen, den Sie kennen, ist es nicht notwendig, ihn den anderen vorzustellen. Sie können sich entschuldigen, für ein paar Sekunden beiseite treten und mit einem Freund sprechen. Aber verzögern Sie das Gespräch nicht, denn andere Leute warten auf Sie.
Menschen, die man häufig trifft, sollten Sie auf jeden Fall grüßen, auch wenn Sie sie nicht kennen. Zum Beispiel beim Verkäufer des nächstgelegenen Ladens, beim Postboten, bei den Nachbarn vom Eingang. Das ist grundlegende Höflichkeit.
Wenn Sie einen Raum betreten, in dem sich viele Menschen aufhalten, sollten Sie nicht alle einzeln begrüßen, sondern ein allgemeines „Hallo“ sagen.
Gemäß der Etikette gibt es drei Hauptarten der Anrede:
1. Beamter – Bürger, Meister;
2. Freundlich – respektierter Kollege, alter Mann, lieber Freund usw.;
3. Vertraut – Schatz, Oma usw. d., nur im engsten Kreis zulässig
1. Mündliche Begrüßung
2. Taktile Begrüßung
3. Begrüßung mit Gesten
Wann ist es nicht üblich, Hallo zu sagen?
Es ist nicht üblich, „Hallo“ zu sagen, wenn die Begrüßung Menschen stören und ablenken könnte, die mit etwas Wichtigerem als Ihrem Aussehen beschäftigt sind. Zum Beispiel während eines Vortrags, einer Besprechung, eines Auftritts. In diesem Fall empfiehlt es sich, den Raum möglichst leise zu betreten, ohne unnötige Aufmerksamkeit zu erregen. An den Rändern werden Sitzplätze eingenommen und die Begrüßung beschränkt sich auf ein Kopfnicken. Während der Pause haben Sie die Möglichkeit, Hallo zu sagen, sich für Ihre Verspätung und die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und Ihren zugewiesenen Platz einzunehmen.
Scheuen Sie sich nicht, den Leuten Hallo zu sagen. Begrüßen Sie die Menschen, denen Sie begegnen, freudig und positiv. Sie werden nicht nur Ihre Mitmenschen aufmuntern, sondern auch mit positiven Emotionen aufgeladen und als angenehmer und süßer Mensch bekannt sein!
Überprüfen Sie Ihren Aufsatz und korrigieren Sie Grammatikfehler. Warum muss man lesen und schreiben können? Früher haben nicht alle Menschen Lesen und Schreiben gelernt. Zuallererst AlphabetisierungSie müssen ein Mensch sein, um Ihre Gedanken richtig ausdrücken zu können und ein Gespräch zu verschiedenen Themen führen zu können. Damit alles klar ist, sowohl schriftlich als auch mündlich. Schließlich haben Analphabeten eine schlechte, ausdruckslose Sprache. Sie können nur die einfachsten Gedanken ausdrücken, und ein komplexer Gedanke, der Erklärungen und Ergänzungen erfordert, wird ihnen Schwierigkeiten bereiten. Die Art und Weise, wie ein Mensch spricht, bestimmt, wie gebildet er ist Gute Arbeit nicht so einfach, und wenn man auch Analphabet ist, dann ist es völlig unmöglich. Es macht einen sehr unangenehmen Eindruck, wenn jemand falsch spricht. Wenn eine Person die Sprache fließend beherrscht, kann sie jeden Gedanken ausdrücken. Um an einem Gespräch teilnehmen zu können, müssen Sie die Sprache gut beherrschen.
Helfen Sie mir, abgeleitete Präpositionen in diesem Text zu finden. Vielen Dank im VorausVor langer Zeit, in der Antike, lebte ein alt aussehender Mann. Sein Name war Efim Dmitrievich, aber alle Leute nannten ihn Juschka. Er war „klein und dünn; auf seinem faltigen Gesicht wuchsen statt Schnurrbart und Bart einzelne graue Haare; Seine Augen waren weiß wie die eines Blinden, und in ihnen war immer Feuchtigkeit, als würden niemals erkaltende Tränen. Juschka war vierzig Jahre alt, aber er litt schon lange unter der Schwindsucht und ließ ihn vorzeitig altern, so dass er für alle altersschwach erschien.“
Er arbeitete in der Schmiede als Gehilfe des Chefschmieds: „Er trug Wasser, Sand und Kohle zur Schmiede; fächerte den Ofen mit Fell auf; hielt das heiße Eisen mit einer Zange auf dem Amboss, während der Chefschmied es schmiedete; brachte das Pferd zur Drehbank, um es zu beschlagen, und erledigte alle anderen Arbeiten, die erledigt werden mussten.“
Juschka wohnte in der Wohnung des Schmiedebesitzers, in der Küche. Der Besitzer gab ihm für seine Arbeit Essen, und Juschka musste von seinem Gehalt Tee, Zucker und Kleidung kaufen. Aber Juschka kaufte keinen Tee und keinen Zucker, er trank Wasser und trug viele Jahre lang die gleiche Kleidung, ohne sich umzuziehen: Im Sommer trug er Hosen und eine Bluse, schwarz und rußig von der Arbeit, von Funken durchbohrt. Im Winter zog er über seiner Bluse einen Schaffellmantel an, den er von seinem verstorbenen Vater geerbt hatte, und zog Filzstiefel an, die einzigen, die er sein ganzes Leben lang hatte.
Als Juschka am frühen Morgen die Straße zur Schmiede hinunterging, begannen alle Bewohner aufzustehen. Und am Abend, als Juschka zum Übernachten kam, sagten die Leute, es sei Zeit zu Abend zu essen und ins Bett zu gehen – „und Juschka ist schon zu Bett gegangen.“
Als die Kinder Juschka sahen, hörten sie auf, auf der Straße zu spielen, rannten hinter ihm her und warfen trockene Äste und Steine nach ihm. Juschka antwortete den Kindern nicht und fühlte sich von ihnen nicht beleidigt. Die Kinder verstanden nicht, warum er sie nicht ausschimpfte, einen Zweig nahm und sie jagte, wie alle anderen es auch tun. Aber Juschka ging und schwieg. Dann begannen die Kinder selbst wütend auf ihn zu werden. Sie drängten ihn noch stärker und schrien. Er sagte ihnen: „Wovon redet ihr, meine Lieben? Warum seid ihr Kleinen!... Ihr müsst mich lieben!... Warum braucht ihr mich alle?...“ Aber die Kinder schubsten Juschka immer noch und lachten ihn aus. Sie waren froh, dass sie mit ihm machen konnten, was sie wollten, aber er tat ihnen nichts. Juschka war auch glücklich. „Er glaubte, dass Kinder ihn liebten, dass sie ihn brauchten, nur dass sie nicht wussten, wie man einen Menschen liebt und nicht wusste, was man aus Liebe tun sollte, und deshalb quälten sie ihn.“
Auch ältere Erwachsene, die Juschka auf der Straße trafen, beleidigten ihn manchmal und schlugen ihn sogar. Juschka lag dann lange Zeit im Staub auf der Straße. Als er aufwachte, stand er alleine auf und manchmal holte ihn die Tochter des Schmiedebesitzers Dascha ab. „Es wäre besser, wenn du stirbst, Juschka“, sagte Dasha. - Warum lebst du? Juschka war überrascht. Er verstand nicht, warum er sterben sollte, wenn er zum Leben geboren wurde. „Die Leute lieben mich“, antwortete Juschka. Worauf Dasha lachte: „Du hast jetzt Blut auf deiner Wange, und letzte Woche wurde dein Ohr zerrissen, und du sagst, dass die Leute dich lieben! …“
Wegen seiner Krankheit verließ Yushka jeden Sommer seinen Besitzer für einen Monat. Von Juli bis August legte Juschka einen Rucksack mit Brot und angesammeltem Geld auf seine Schultern und verließ die Stadt. Er ging zu Fuß in ein abgelegenes Dorf, in dem seine Verwandten lebten. „Unterwegs atmete er den Duft von Gräsern und Wäldern ein, betrachtete die weißen Wolken, die am Himmel geboren wurden, schwebten und starben in der hellen, luftigen Wärme, lauschten den Stimmen der Flüsse, die auf den Steinspalten murmelten, und Juschkas schmerzender Brust Ausgeruht fühlte er sich nicht mehr krank. Er saß im Schatten eines Straßenbaums und döste in Frieden und Wärme.“
Einen Monat später kehrte Juschka in die Stadt zurück und arbeitete erneut von morgens bis abends. Er begann zu leben wie zuvor, und wieder machten sich Kinder und Erwachsene über Juschka lustig und warfen ihm seine unerwiderte Dummheit vor. Doch Jahr für Jahr wurde Juschka schwächer, sein Leben neigte sich dem Ende zu und eine Brustkrankheit quälte ihn. Eines Sommers, als für Juschka die Zeit nahte, in sein fernes Dorf zu gehen, ging er nirgendwo hin. Er verließ, wie üblich abends, schon im Dunkeln, die Schmiede.
Ein Passant, der Juschka kannte, lachte ihn aus: „Warum zertrampelst du unser Land, Gottes Vogelscheuche!“ Und Juschka wurde zum ersten Mal in seinem Leben wütend: „Warum störe ich dich? Warum störe ich dich! Meine Eltern haben mir den Auftrag gegeben zu leben, ich wurde nach dem Gesetz geboren, die ganze Welt braucht mich auch.“ , genau wie du, auch ohne mich, das heißt, es ist unmöglich.“ „Spalt mir nicht die Haare! - schrie ein Passant. „Schau, ich rede, ich werde dir deinen Verstand beibringen!“ Ein Passant stieß Juschka wütend gegen die Brust und er stürzte. Der Passant ging. „Nachdem er sich hingelegt hatte, drehte Juschka sein Gesicht nach unten und rührte sich nicht, noch stand er wieder auf.“
Ein Tischler aus einer Möbelwerkstatt kam vorbei. Er entdeckte, dass Juschka gestorben war. „Er ist tot“, seufzte der Zimmermann. - Auf Wiedersehen, Juschka, und vergib uns allen. Die Leute haben dich abgelehnt, und wer ist dein Richter?
Der Besitzer der Schmiede bereitete Juschka für die Beerdigung vor. Diejenigen, die ihn kannten, sich über ihn lustig machten und ihn zu Lebzeiten quälten, kamen nach Juschka, um sich zu verabschieden. Dann wurde Juschka begraben und vergessen.
Aber ohne Juschka wurde das Leben der Menschen schlimmer. Nun blieben all die Wut und der Spott im Volk, denn es gab keine Juschka, die alles unerwidert ertragen musste.
In eins Herbsttag Ein junges Mädchen kam zur Schmiede und fragte den Besitzer-Schmied, wo sie Efim Dmitrievich finden könne.
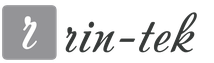










Beruf Entwicklungsdirektor Aufgabenbereiche des Direktors für regionale Entwicklung
Kursarbeit: Liquidität und Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens, Bewertungs- und Managementmethoden
Verwendung logistischer Leistungsindikatoren
Konzept und Elemente des Logistikprozesses
Stellenbeschreibung des Leiters der Abteilung Kraftverkehr Stellenbeschreibung des Leiters der Abteilung Transportverpackung